Als Tarik Zeki seine Tochter in eine vornehme Kindertagesstätte in Berlin bringt, ruft dies Angst und Misstrauen beim Personal und den Eltern hervor. Die Geschichte einer Vorverurteilung.
Text: Susanne Donner Illustrationen: Marwa Yasin
An diesem Tag im März 2016 drücken die Wolken dick und voluminös wie klamme Daunendecken auf die Stadt und verlaufen mit dem milchig-trüben Nebel in der Luft. Das Wetter bringt den Menschen in eine triste Zwischenzone, nicht Tag, nicht Nacht, findet Tarik Zeki und denkt einen Augenblick an den schwarzblauen Sternenhimmel bei Nacht und die gleißende Sonne am Tag in seiner Heimat Ägypten. Die Gegenwart lässt ihm keine Zeit, solchen Gedanken nachzuhängen. Seine Tochter Soraya quengelt und kniet, das Gesicht zu ihm gedreht, im Kinderwagen. Er nimmt sie auf seinen linken Arm und balanciert den Wagen schlingernd mit der Rechten über das Kopfsteinpflaster. Soraya liebt diesen Sitz, auf Augenhöhe mit ihrem Vater wippt sie in ihrem grünen Skianzug und ihrer roten Bommelmütze darauf wie eine kleine Königin in ihrer Sänfte. Und sie ist ja auch seine Königin, sein erstes Kind, etwas mehr als ein Jahr alt.
Das Brummen entfernter Baumaschinen schallt über die Straße, sonst regt sich nichts in der Auffahrt zur Kindertagesstätte. Es ist eine jener Betriebskindertagesstätten eines erlesenen Arbeitgebers, für die Architekt:innen viele Zeichnungen anfertigen und vom Stäbchenparkett bis zu den Turngeräten an nichts sparen. Ruhig für die Kinder und doch unglaublich zentral. Zekis Frau arbeitete dort vor der Geburt, weshalb die Familie den seltenen Vorzug genießt, dass Soraya hier untergebracht werden darf. Die meisten Väter und Mütter sind Akademiker:innen, haben Politikwissenschaften oder Jura studiert, sind sehr gebildet, mit guten Manieren und auf jedes Wort bedacht, weil sie selbst Politiker:innen sind oder für Politiker:innen arbeiten. Sie sind den Mächtigen nahe oder zählen sogar selbst dazu. Wer sein Kind in diese Kita bringt, gehört meist zu den «späten» Vätern oder Müttern, Durchschnittsalter Anfang vierzig.
Zeki drückt die Klingel «Kindertagesstätte» neben einer metallenen, schweren Pforte, die zwei Meter in die Höhe ragt und mit scharfkantigen Zacken abschließt. Nichts geschieht. Von draußen kann er nicht ungehindert nach drinnen schauen, denn das gesamte Gelände ist von einer zweieinhalb Meter hohen, dicht gewachsenen Hecke eingefasst. Nur durch die Blätter und die Ritzen neben dem Metalltor kann er das Gebäude sehen. Die Videokamera auf einer Säule neben dem Eingangstor ist auf ihn und Soraya gerichtet. Es rauscht in der Gegensprechanlage: „Was möchten Sie hier?“, ertönt eine Frauenstimme. Zeki ist nervös. Er hat Angst vor dieser Sprache mit den vielen Sch- und Ch-Lauten und auch vor den Deutschen, über die er in seiner Heimat als Erstes hörte, dass sie Ausländer nicht mochten und recht unfreundlich sein könnten. Nun muss er diese zurechtgelegten Worte, die er zig Male in der Straßenbahn gemurmelt hat, akkurat aussprechen. „Ich bin der Vater von Soraya und bringe meine Tochter.“ Einen Moment Stille. Die Is und Os waren nicht deutlich genug ausgesprochen, denkt er und steht, die Muskeln angespannt, vor dem Tor. „Welche Gruppe?“, ein Anflug von Schärfe liegt im Ton der Frau. „Regenbogengruppe.“ Ein Name wie ein Codewort beim Einlass in eine mittelalterliche Burg. Es sirrt. Zeki drückt das Metalltor auf. Den anderen Eltern öffnet das Kita-Personal gewöhnlich direkt, ohne auch nur eine einzige Frage zu stellen.
Er spürt die Augen der vielen Mütter und Erzieherinnen und der wenigen Väter und Erzieher auf sich. Ein arabischer Mann, der seine Tochter in diese Kita bringt. Er trägt sportliche Jeans, Bomberjacke und Turnschuhe, wo die anderen gewöhnlich in feinen Kostümen, Anzügen, Hemden und Blusen entlanglaufen. Die Pupillen der Väter und Mütter werden groß angesichts dieses Fremdkörpers und versuchen irritiert, das außergewöhnliche Bild zu erfassen. Sein Haar ist schwarz und dicht, gelockt und kurz, der Teint kaffeebraun, die Brauen dicht und kräftig, und die Augen sind schwarz. Er ist jung, 27, man könnte ihn auch noch jünger schätzen, weil er drahtig und klein gewachsen ist in seinem athletischen, immer zum Sprung bereiten Körper.
Er sieht viel jünger aus als die deutschen Väter in dieser Kita. Aber erst dieses Kind! Wenn die Augen nicht durch den Vater schon irritiert waren, sind sie es umso mehr, wenn sie das kleine Mädchen erblicken. Sie verweilen länger, als es jeder Anstand gutheißt, auch, weil diese Soraya hoch oben auf dem Arm des arabischen Mannes thront, mit blitzenden Augen lächelt und noch dazu bildhübsch ist. Aber das würde nur für Sekundenbruchteile der Attraktion reichen. Was wirklich verfängt: Dieses Mädchen sieht beim besten Willen nicht arabisch aus. Sanft gelocktes zimtbraunes Haar fällt über seine Schultern. Die Haut ist viel zu hell für das Ausland, und ihre Augen sind graublau. Nicht vom Vater hat sie das, sondern vom Großvater der Mutter, aber diese Information fehlt in den Köpfen der anderen natürlich. Und so fragen ihre verstörten Gesichter: Wer ist das? Was macht ihr hier?
Die Blicke der anderen Eltern machen ihm Angst
Eine gute Woche später: Neben der Eingangstür der Kindertagesstätte sitzt Margitta Würde im Kontrollraum. Über dem Schreibtisch hängen Monitore, die die Bilder der verschiedenen Videokameras in und außerhalb der Kita zeigen. Hinter Margitta Würde leuchten grüne und rote Leuchtdioden auf einer gewaltigen Tafel, die den Grundriss der Einrichtung abbildet. Ein grünes Licht bedeutet, dass die Tür zu diesem Raum offen ist und vermutlich Kinder darin sind. Ein rotes Leuchten heißt abgeschlossen. „Hier sind wir eben an einem sensiblen Ort“, sagt Würde. Sie sieht die Menschen auf den Bildschirmen klein und gedrungen, die Gesichter der Eltern und Kinder in die Breite gezerrt, in gespenstischem Grau-Schwarz. Da sieht sie, wie ein arabischer Mann mit leerem Kinderwagen und einem Kind auf dem Arm vorbeihastet. Sie stutzt und murmelt nur: „Wer ist denn das?“ Ihr Rücken richtet sich etwas auf. Sie schiebt den Drehstuhl zurück, so dass sie durch die geöffnete Tür auf den Flur schauen kann. „Den habe ich hier noch nie gesehen, sieht arabisch aus“, erklärt sie etwas reserviert, „wir haben unsere Anweisungen.“
Zeki hat sich nach ein paar Tagen daran gewöhnt, auf das „Ja, bitte?“ nach dem Betätigen der Klingel seinen einstudierten Satz aufzusagen. Aber an diese Angst in den Gesichtern der anderen Eltern, diese erschrockene Verstörung, kann er sich nur schwer gewöhnen. In seinem Land haben die Augen gelacht oder Gleichgültigkeit verbreitet, und wenn sie übellaunig verengt waren, dann wenigstens nicht seinetwegen. Ich bin doch nur ein Vater, der seine Tochter in die Kita bringt, denkt er. Aber auch er hat Angst vor diesen schön gekleideten, distanzierten Menschen aus einer fremden Welt und einer anderen gesellschaftlichen Schicht.
„Hallo“, sagt er zur Kitabetreuerin der Regenbogengruppe. „Hallo“, kommt es zurück. Dann überreicht er ihr Soraya wie ein kostbares Paket, wortlos, zu scheu, um mehr zu sagen. Und auch die Kitabetreuerin sagt nichts, weil sie nicht weiß, was sie einem arabischen Vater sagen kann und was der versteht. Als Soraya Hautausschlag in der Windelzone hatte, hat sie lieber Zekis Frau zu Hause angerufen. Seit seine Frau hochschwanger ist und sich schonen muss, bringt Zeki Soraya jeden Tag in die Kita. Zeki kommt aus der Toilette der Kita und will gerade das Gebäude verlassen, da läuft eine Frau mit Brille und blondem Pferdeschwanz aus dem Kontrollraum so schnell und zielstrebig auf ihn zu. Es ist Margitta Würde, die ihn auf dem Monitor beobachtet hat. „Was machen Sie da?“ Er ist so erstaunt, dass er sogar seine Scheu zu sprechen vergisst. „Ich war auf dem Klo“, sagt er. „Wer sind Sie denn bitte?“ „Der Vater von Soraya aus der Regenbogengruppe.“ „Und wo haben Sie den Kinderwagen abgestellt?“ Als er einen Augenblick verständnislos schaut, weil er nicht glauben kann, dass dieses Verhör wirklich stattfindet, wiederholt sie: „Den Kinderwagen?“ Er zeigt mit dem Finger in Richtung des Kinderwagenabstellraums. „Kinderwagen dort“, sagt er und verschluckt vor Aufregung den Artikel und das Verb. In diesem Moment begreift er, dass auch die anderen vor ihm Berührungsängste haben, so wie er sich vor dem Kontakt mit ihnen fürchtet. Und dass er aber im Gegensatz zu den anderen für Margitta Würde verdächtig ist.
Sie hat noch nie einen anderen Vater oder eine andere Mutter derart befragt. Zekis Anblick beunruhigte sie, weil sie unsicher war, ob er in die Einrichtung gehört, und falls nicht, weshalb er in der Kita auftaucht. „Sie können immer gleich hinausgehen, wenn Sie Ihre Tochter gebracht haben“, sagt Würde zu Zeki und deutet in Richtung des Ausgangs. In ihrer Stimme liegt Erleichterung und Besänftigung. Sie versucht ein Lächeln, das zu künstlich gerät, weil ihr die Anspannung noch in den Gesichtsmuskeln steckt. Zeki ist verdächtig. Muslim, männlich, Ende zwanzig, aus einem arabischen Land nach Europa zugewandert – sein Anblick löst an diesem sensiblen Ort mitunter Verstörung aus.

Ihre Sinne suchen den Terroristen in ihm
Sandra Erling beobachtet Zeki im April 2016 zum ersten Mal, wie er mit schnellem Schritt die Kita verlässt. Ein junger Araber, den sie noch nie gesehen hat. Erling bringt ihre Tochter in die Kita. Zeki eilt an ihnen vorbei Richtung Ausgang. Sie denkt sofort an die Terroranschläge in Brüssel und Paris. Ihre Gedanken galoppieren so schnell, dass sie ihnen kaum folgen kann. Was macht der hier? Ohne Kind! Es gibt so gut wie keine Ausländer in dieser Einrichtung im Unterschied zu anderen Kitas. Und diese dicke Bomberjacke, hat er da den Sprengstoffgürtel drunter? Zu schnell läuft er an ihr vorbei, viel zu schnell. Sandra Erling geht weiter, wie ein Roboter starr und mechanisch vor Entsetzen. Sie dreht sich um. Da ist der Mann auch schon zur Tür hinaus. Erling stockt. Nichts ist geschehen, während ihre Sinne immer noch angestrengt den Terroristen in ihm suchen. Erling drückt die Tür zur Sternengruppe auf und umarmt wie in Trance ihre Tochter zum Abschied, länger als sonst. In ihrem Brieffach in der Kita steckte einige Tage zuvor eine Einladung zur Elternversammlung: „Sicherheit in der Kindertagesstätte“. Erling atmet schneller. „Sie machen sich Gedanken um die Sicherheit, das bedeutet, dass es nicht absolut sicher ist.“ So erinnert sie sich später an die erste Begegnung mit Zeki.
Erling ist Juristin, immer akkurat geschminkt, 40 Jahre alt. Sie kennt nicht viele Menschen aus dem Orient. Als sie noch als Scheidungsanwältin arbeitete, fand sie die Trennungen arabischer Paare immer am brutalsten. Und ehe sie vor einigen Jahren in den Schnorchelurlaub am Roten Meer aufbrach, hatte sie gegen ihre Angst gekämpft, eine Gruppe Taliban würde mit einem Motorboot am Strand anlanden und sie und ihren Partner mit Kalaschnikows niedermähen, weil Erling sich unsittlich in einem Bikini gesonnt hatte. Es wurde am Ende ihr schlechtester Urlaub, weil die ägyptischen Kellner des Hotels, wie sie fand, die einheimischen Gäste bevorzugten und sie und ihren Mann nur zögerlich bedienten. Ihre schönste Reise führte sie vor Jahren auf die Malediven, wo sie schnorchelnd über die bunten Fische und Korallen staunte. Als sie bei einem Bummel durch die Hauptstadt Malé die verschleierten Musliminnen sah, war ihr dieser Anblick unheimlich. Nur ein Erlebnis später, in Berlin, wollte nicht in ihr Vorstellungsmosaik zu arabischen Ausländern passen: Einmal brach sie an einer Haltestelle im Stadtzentrum fast zusammen, weil ihr Kreislauf sie im Stich ließ. Ein Libanese war es, der sie diskret stützte und in ein Taxi setzte. Am Tag darauf hatte sie sich erholt. Sie erzählt diese Geschichte bis heute mit einem Ton der Verwunderung und presst am Ende die Lippen aufeinander, als dürfte sie nicht weiterreden.
Erling ist SPD-Wählerin, seit sie 18 Jahre alt ist. Sie fordert, dass Ausländern in Deutschland mehr geholfen wird. Sie hat Verständnis dafür, dass all die zugewanderten Menschen in großer Not waren. Und doch ängstigt sie das Andere, das Fremde, wie sie sich überhaupt schnell Sorgen macht. Die Vorstellung, ihrem Kind könnte etwas zustoßen, ist für sie apokalyptisch.
Sciherheitsmaßnahmen
Ein Tag im April 2016. Elternversammlung. Ein Polizeisprecher, mindestens 60 Jahre alt und mit ruhigem, aber wachem Gesichtsausdruck, und sein Mitarbeiter, sehr jung und etwas aufgeregt, sitzen vor Mikrofonen, daneben die Leiterin der Kita, eine ernst wirkende Mitt- fünfzigerin mit Kurzhaarschnitt. In dieser besonderen Kita gerät die Elternsprechstunde zur Pressekonferenz. Die Hälfte der Eltern ist gekommen. „Die Gefährdungslage ist abstrakt hoch wie in allen Großstädten“, beginnt der Polizeisprecher, „und kann sich jederzeit in einem Anschlag realisieren. Es liegen jedoch keine konkreten Hinweise auf einen solchen vor.“
Die Aneinanderreihung von Polizeivokabeln soll die Lage präzise beschreiben, aber sie beunruhigen mehr als dass sie informieren. Eine angespannte Stille legt sich auf die Anwesenden, die mit steifen Rücken und gebannten Blicken auf ihren Stühlen sitzen. Ein junger Vater reckt den Arm für eine Wortmeldung. Er zwängt seine Stimme in ein Korsett aus professioneller Sachlichkeit, aber der innere Aufruhr lässt ihm die Atempausen entschwinden. Die Einrichtung sei so exponiert und schlecht geschützt, sagt er. Dabei habe doch im vergangenen Jahr sogar die deutsche Schule in Istanbul wegen einer Anschlagsdrohung geschlossen werden müssen. „Muss erst etwas passieren, ehe man mehr für die Sicherheit tut?“
Es ist eine Woge der Angst, die sich langsam und unsichtbar tief unten am Seelengrund der Eltern aufbaut und dann auf die Polizisten zubrandet. Der ältere Polizist will ihre Wucht mildern, als er sagt, vieles sei natürlich denkbar, man könne sogar eine drei Meter hohe Betonmauer um die Kita errichten und eine Pforte zur Einlasskontrolle davor bauen. Aber sähe das dann noch wie eine Kita aus? Und wer wolle ernsthaft in eine so gesicherte Einrichtung sein Kind geben? Und wenn jeder kontrolliert werden müsse, könne man nicht zwei Minuten vor neun Uhr in die Kita gehen und um neun Uhr am Arbeitsplatz sein.
„Sie dagegen können viel tun“, appelliert er schließlich an die Eltern. „Sie sollten nicht jedem hinter sich das Eingangstor aufhalten und jeden hineinlassen, den Sie nicht kennen.“ Aber die Welle der Angst ist schon zu mächtig, so dass der Versuch des Polizisten, sie in konstruktive Bahnen zu lenken und sich mit den Sicherheitsmaßnahmen zu beschäftigen, scheitert. Sie mache sich Sorgen um die Sicherheit, sagt eine Mutter. „Gibt es wenigstens einen roten Alarmknopf, den man drücken kann, wenn jemandem etwas Verdächtiges auffällt?“ Was für eine gute Idee, denkt Erling und erinnert sich wieder an den Schrecken, der sie beim Anblick des arabischen Mannes erfasste.
Der Polizeibeamte ändert die Taktik erneut. Man werde nun Anregungen aufnehmen und deren Umsetzung prüfen. Er macht sich eine Notiz. Eine Mutter in weißer Bluse fragt, ob ein Attentäter mit einer Pistole durch die Fenster schießen könne. Sie wolle wissen, wie sicher das Glas sei. Gemurmel unter den Eltern, und einer sagt, was wohl viele denken: „Wenn ein Islamist den Kindern etwas antun möchte, kann er doch einfach durch die Hecke schießen.“ Die Kinder spielen vom Frühjahr bis zum Herbst fast jeden Tag im Garten. Der Polizist versucht diesem Szenario mit Sachlichkeit zu begegnen: Nur die Fenster zur Straße seien aus schussabwehrendem Glas, was aber auch bedeute, dass sie bei einem Feuer schwerer einzuschlagen seien. Man könne sich vorstellen, sämtliche Fenster aus solchem Spezialglas zu fertigen. Wenn aber auch die Türen daraus hergestellt würden, würden diese so schwer, dass die Kinder sich darin quetschen könnten.
Die Angst der Eltern ist offenbar grösser, als er erwartet hat. Er übergibt das Wort an seinen jungen Kollegen, der jetzt denkbare Maßnahmen vorstellen soll, um die Sicherheit zu erhöhen. Spezielle Ausweise für die Zugangsberechtigten könnten ausgegeben und ein Einlasssystem könnte eingerichtet werden. Allerdings müsse der ohnehin kleine Garten dann noch kleiner werden, da dort eine Pforte aufgebaut werden müsse. Man könne aber wenigstens eine kindgerechte Bauweise wählen, etwa in Form eines Fliegenpilzes. Auch einen Alarmknopf, der die vollständige Verriegelung aller Räume auslöse, in denen sich Kinder befänden, könne man einbauen. Solche Systeme würden in Schulen zum Schutz vor Amoktätern eingesetzt. Man wolle auf oder hinter die Hecke einen Schutz aus durchsichtigem Spezialkunststoff bauen. Damit hätten die Kinder trotzdem Sonne im Garten. Das Schild an der Tür solle entfernt werden, damit Passanten nicht wüssten, um welche Einrichtung es sich handele. Auf Google Maps ist die Kita schon zu diesem Zeitpunkt unkenntlich gemacht, gibt man die Adresse ein, bleibt das Bild schwarz. Die Mülltonnen vor der Kita sollten einen anderen Platz bekommen, damit Außenstehende keine Tatobjekte einbringen können. Es seien auch viele, nicht sichtbare Maßnahmen im Gespräch, die er hier nicht nennen könne – eben aus Sicherheitsgründen.
Das Unsicherheitsgefühl ist übermächtig
Einen Augenblick lang ist es still im Saal. Da meldet sich ein Vater mit strubbeligem Haar und grobmaschigem Strickpullover. „Ich weiß, dass ich hier offenbar eine Einzelmeinung vertrete, aber ich finde das eine absolut gespenstische Sicherheitsdebatte.“ Er habe keine Angst, wenn er seine Kinder in die Kita bringe, und er wolle sich hier ausdrücklich gegen eine Militarisierung der Einrichtung wenden. In eine solche Kita würde er seine Kinder nicht mehr bringen wollen. Er plädiere sehr für einen Mittelweg. Eine junge Mutter, eine bekannte politische Persönlichkeit, erhebt sich. Sie habe keine Angst, sobald sie ihr Haus mit ihren drei Kindern verlasse. Sie sei ganz und gar gegen eine Einlasskontrolle, das sei kompliziert und koste die Eltern viel Zeit. Und der Garten sei für die Kinder wichtiger, als diesen Platz für zusätzliche Sicherungssysteme zu opfern.
Vielleicht könnten beide Einwände die Debatte drehen, wäre das Unsicherheitsgefühl nicht übermächtig. Es bestünde ja kein Zwang, das Kind in diese Einrichtung zu geben, entgegnet eine Mutter mit leicht aggressivem Unterton, wohl wissend, dass die Mehrzahl der Anwesenden ihrer Meinung ist. Und eine andere Frau fragt kleinlaut, was man denn nun machen solle, wenn sich ein Angriff auf die Kita ereigne. Der ältere Polizeibeamte wiegt den Kopf, verzieht aber keine Miene: Diese Frage nach einem unwahrscheinlichen Fall könne man so pauschal nicht beantworten, denn das komme auf das genaue Szenario an. Aber die Eltern könnten sicher sein: Die Polizei und das Personal seien auf sehr unterschiedliche Szenarien vorbereitet und auch stets über die aktuelle Gefährdungslage informiert. Es gäbe sichere Sammelplätze für Eltern und Kinder, und ohnehin wäre die Polizei in kurzer Zeit vor Ort.
Eine Kindertagesstätte ist eigentlich ein Ort der unbeschwerten Kinderfreude, mit Raum für Spiel und Spaß, wo die Kleinen lachen, toben, singen, malen, und ja, auch schubsen und kreischen. Aber weil sie so nah an der politischen Macht ist, ist diese Kita ein Ort der Angst.
Mit einer seltsamen Mischung aus Sorge und Beruhigung verlässt Sandra Erling den Saal. Man tut etwas für die Sicherheit, das beschwichtigt sie. Aber die vielen Einwände der anderen Eltern haben noch mehr Bilder des Schreckens in ihrem Kopf entstehen lassen. Ihr fällt auch auf, dass niemand den arabischen Mann erwähnt hat. Wäre er als Vater selbst zur Elternversammlung erschienen, wäre Erlings Verdacht gegen ihn von der einen Sekunde auf die andere verschwunden. Aber Zeki hat gefehlt.
Zeki ist am Tag der Elternversammlung zu Hause geblieben – aus Scheu vor all den Augenpaaren, die ihn mustern würden, den einzigen Ägypter in der ganzen Einrichtung, weil man ihn als Vater kaum kennt. Zeki hätte sich gefühlt wie ein Tier im Zoo. Dass sich diese Situation der gegenseitigen Angst nur auflösen kann, wenn ihn alle Eltern und Mitarbeiter der Kita kennenlernen, so weit denkt er zu diesem Zeitpunkt nicht. Zeki denkt sich: Seinetwegen könnte man ein Foto von ihm an das schwarze Brett im Eingangsbereich der Kita hängen und ihn als ausländischen Vater vorstellen, wenn es hälfe. Aber selbst wenn er nicht in seiner lähmenden Kontaktscheu gefangen wäre, würde er nie mit einem so ausgefallenen Vorschlag an die Leiterin der Kita herantreten.
Vor den Kindern hat er keine Furcht.
Im Mai 2016 laden die beiden Betreuerinnen der Regenbogengruppe die Eltern mit ihren Kindern zu Kaffee und Kuchen ein. Die Eltern kennen einander fast gar nicht. Diese Anonymität wollen die Pädagoginnen ein wenig aufweichen. Viele Eltern bringen gekaufte Kekse und einige sogar selbstgebackene Obst- und Sandkuchen mit. Trotz des Unbehagens, das die Vorstellung erschrockener Blicke ihm bereitet, entscheidet sich Zeki, mit seiner Tochter zu dem Fest zu gehen, da er weiß, wie sehr es Soraya lieben wird, mit all den Lenas und Claras, Eva-Marias und Maximilians zwischen den Stühlen und Beinen der Erwachsenen herumzutoben. Mit einem knappen „Hallo“ und einem Begrüßungslächeln stellt er eine Schale Obst auf den Tisch mit den Speisen. Weder die zwei Väter noch die vielen Mütter kennen ihn, aber auch diese scheinen sich untereinander fremd zu sein. Sie sitzen etwas steif auf den Holzstühlen und halten eine Tasse oder einen Teller in der Hand, ihre Kinder klammern sich an ihre Beine aus Scheu vor all den fremden Leuten. Irgendjemand sagt etwas über das Wetter. Die Betreuerin heißt alle willkommen. Eine Mutter, eine promovierte Juristin, lobt den Erdbeerkuchen, während eine andere nachfragt, ob darin Milchprodukte seien, weil ihr Kind diese nicht vertrage. Die Eltern sind höflich und bedächtig, aber an diesem Nachmittag bleiben sie ein wenig steif und unterkühlt. Jedenfalls kommen sie über bruchstückhaften Smalltalk hinaus nicht miteinander ins Gespräch.
Soraya löst sich als Erste von ihrem Vater und bringt ihm aus einer Ecke des ihr vertrauten Ortes ein Spielzeugtelefon. „Ah, ein Telefon“, sagt er auf Arabisch und freut sich. Daraufhin setzt ein heiteres Spiel zwischen ihm und Soraya ein. Sie nimmt ihm das Telefon energisch aus der Hand, trägt es fort und schleppt ein Plastikauto an. „Tu- tuttut“, kommt es aus ihrem Mund. Alle lachen. Ihre Spielfreude steckt die anderen Kinder allmählich an. Die anderen Kinder kennen Zeki gut, weil er seine Tochter jeden Tag holt und bringt. Sie rufen „Papa“, wenn er eintritt, weil er sie an ihren eigenen Vater erinnert oder weil sie sagen wollen, Sorayas Papa sei da. Lena schleppt ihm eine Puppe an und bleibt bei ihm stehen und brabbelt etwas von „Puppa zu Hause“. „Ah, du hast eine Puppa zu Hause“, wiederholt er und lacht, „das ist schön.“ Die Kinder sind wie er. Sie können die Wörter nicht richtig aussprechen und machen ständig Fehler. Deshalb hat er keine Furcht, mit ihnen zu scherzen.
Anfangs wagte er das beim Bringen und Abholen nur, wenn die Betreuerinnen nicht in der Nähe standen. Später vergaß er sie bald ganz. Max drückt ihm das Plastikauto in die Hand und plappert Sorayas „Tututtut“ nach. Das rege Treiben um Zeki herum fällt auf. Später werden die Leute in der Kita sagen: Das ist der Vater von Soraya, ein Ägypter, den die Kinder recht gern haben. Und wenn Soraya über den Flur rennt und einer über die Schönheit dieses Mädchens staunt und fragt, zu wem die Kleine denn gehöre, dann sagt die Betreuerin: zu den Zekis aus Ägypten. Der Papa bringt und holt sie immer, und die Kinder mögen den ganz gern. Auch Sandra Erling hört von diesem Gerücht und spürt, wie ihr schlimmer Verdacht in sich zusammenfällt. Sie hat diesen ungewöhnlich jungen und leger gekleideten arabischen Mann zu Unrecht verdächtigt.
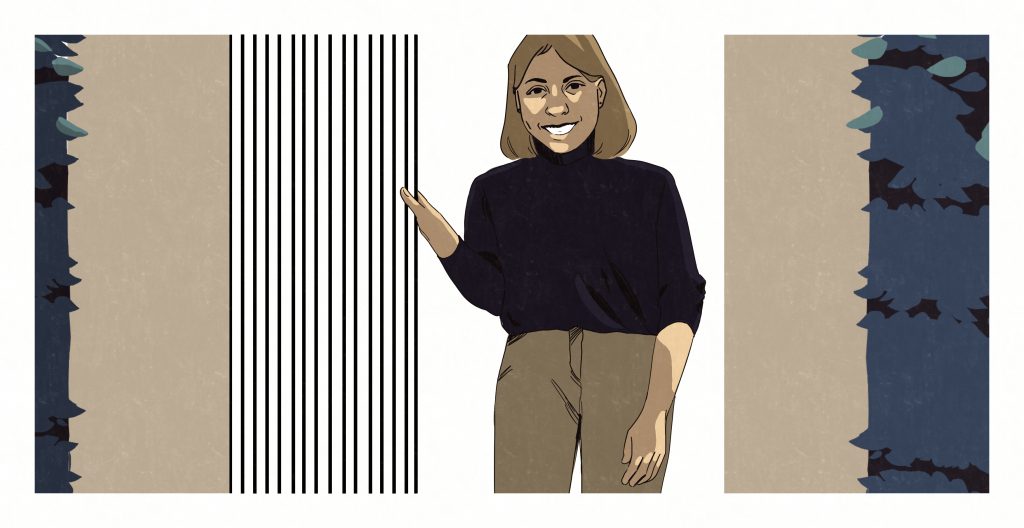
Ein Schatten liegt auf ihrem Gewissen
Einmal trägt Zeki eine große Papiertüte mit Einkäufen, als er Soraya abholen möchte. Bestimmt würde das Personal das für eine Bombe halten, fürchtet er, und schließt sie deshalb vorsorglich in ein Schließfach am Bahnhof ein. Er will nicht noch mehr Aufsehen erregen als er ohnehin schon tut. Das Türschild der Kita ist bereits entfernt und der Briefkasten mit Paketband abgeklebt. Einmal läuft ein Polizist begleitet von einem Trupp der Betreuerinnen über das Dach des Gebäudes.
Doch dann ereignet sich dieser Tag Ende Mai, der Zeki dermaßen überrascht, dass sich die Zwischenzone von Tag und Nacht ein wenig für ihn lichtet. Vor ihm läuft eine Mutter den Gehweg an der Hecke zum Eingang der Kita entlang. Er verlangsamt seine Schritte, um ihnen beiden die Peinlichkeit zu ersparen, dass sie ihm, dem unbekannten, bedrohlichen Araber, die Tür nicht aufhalten darf. Doch die Frau läuft auch langsamer, als wollte sie es ihm gleichtun. Er bleibt stehen und überlegt, sich eine Zigarette anzuzünden. Wie kann man einer nachfolgenden Person eine schwere Metalltür vor der Nase zuschlagen, ohne eine Entschuldigung zu stammeln, dass man sich nur an den Rat der Polizei hält und nicht unhöflich sein will? Man macht in diesem Augenblick den Nachfolgenden zum Verdächtigen. Welche Peinlichkeit! Welche Anschuldigung! Welche Steilvorlage für eine spätere Eskalation! Wie eine banale Geste der Höflichkeit, ein Gebot des gewöhnlichen Miteinander, Unfrieden stiftet, wenn sie fehlt. Die Frau bleibt ebenfalls stehen.
Es ist Sandra Erling. Sie dreht sich um und winkt Zeki zu sich heran, er möge näherkommen. Er fühlt sich, als träume er, beschleunigt aber doch die Schritte. „Guten Tag“, sagt sie, „Sie sind der Vater von Soraya, nicht wahr?“ „Ja“, sagt er. Da geht sie voraus und hält dann hinter sich die Tür auf für Soraya und Zeki. Da sieht er aus dem Augenwinkel Margitta Würde. Sie wechselt ein paar Worte mit Erling und wendet sich dann an Zeki. Der Schrecken, den sie bei seinem ersten Anblick empfand, und ihr adrenalingetriebenes Verhör damals auf dem Flur haben einen Schatten auf ihrem Gewissen hinterlassen: „Wie geht es Ihrer Tochter? Schläft sie schon durch?“ Zeki weiß nicht, was durchschlafen bedeutet, spürt aber, dass sie dieses Mal versöhnlich gestimmt ist. Er entscheidet sich aufs Geratewohl für: „Danke, gut.“
Diese Reportage erschien ursprünglich in der Ausgabe 35 des Schweizer Magazins „Reportagen“.
Susanne Donner ist Journalistin aus Leidenschaft. Ihre Artikel sind in Magazinen wie brand eins, SZ Magazin, Reportagen und in verschiedenen Zeitungen erschienen darunter Die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Süddeutsche Zeitung.








