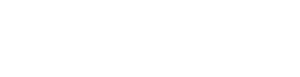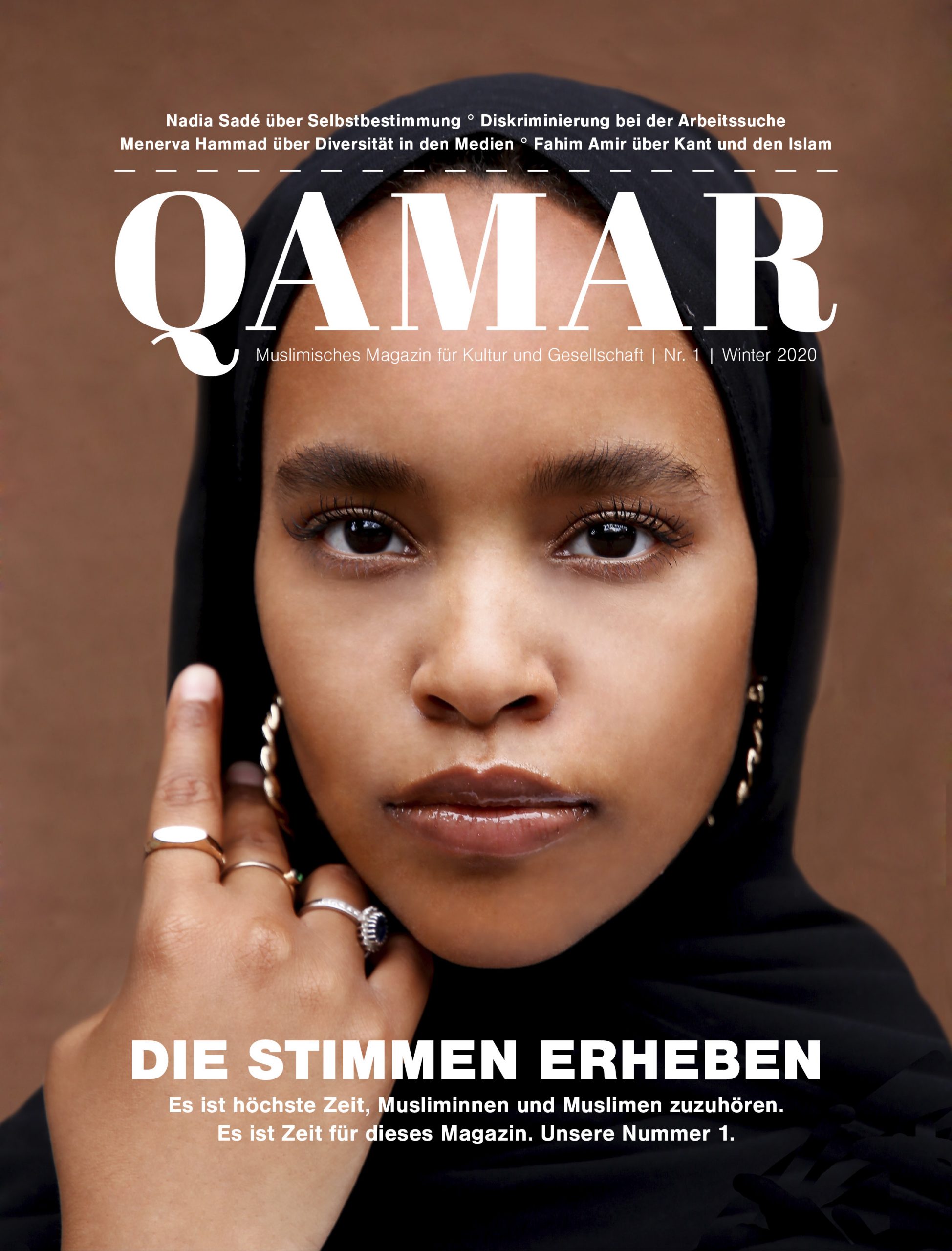Ein Denkmal erinnert in Wien seit Kurzem an das Genozid von Srebrenica. QAMAR war bei der Enthüllung dabei.
Text und Fotos: Salme Taha Ali Mohamed
Am Platz der Vereinten Nationen erblühte am 24. Oktober eine massive Blume aus Stahl. Elf Figuren heben die Blume mit vereinten Kräften empor, ihre weißen Arme unermüdlich gen Himmel gestreckt. Die Zahl steht für den 11. Juli 1995, als über 8.372 Bosniak:innen im Genozid von Srebrenica durch serbische Truppen unter General Ratko Mladić getötet wurden. Die Figuren wiederum repräsentieren die unzähligen bosnischen Mütter und Frauen, die zwar den Genozid überlebten, aber ihre Liebsten verloren haben – Frauen wie Munira Subašić. 22 ihrer engsten Angehörigen wurden auf einen Schlag ermordet.
Sie war bei der Enthüllung des Denkmals – genannt Blume von Srebrenica – anwesend, um an diese Verbrechen in Wien zu erinnern. „Es ist schwer, den Schmerz zu beschreiben, den ich seit 30 Jahren in mir trage“, sagte sie in ihrer Rede. „Ich spreche im Namen von Tausenden Müttern, deren Kinder ermordet wurden. Dieses Denkmal steht nicht zufällig hier, denn unsere Liebsten wurden unter der Flagge der Vereinten Nationen getötet. Das Denkmal wird an unsere ermordeten Kinder gedenken und Hoffnung geben, dass Srebrenica niemals vergessen wird“, fügte sie hinzu.
Die Wahrheit bewahren
Der Kampf gegen das Vergessen ist genau auch der Grund, weshalb sich das Consilium Bosniacum – ein Verband mehrerer bosnisch-herzegowinischer Vereine in Österreich – entschlossen hat, den Bau in Auftrag zu geben. „Die Idee zu diesem Projekt entstand aus einem tiefen Bedürfnis, die Wahrheit über den Genozid dauerhaft zu bewahren. Wir wollen, dass weder Europa noch die Welt jemals vergisst, was im Juli 1995 geschah“, so Damir Saračević, Obmann des Consilium Bosniacum.
Über Hundert Menschen hatten sich am Platz der Vereinten Nationen neben der U1-Station Kaisermühlen versammelt, um der Enthüllung beizuwohnen. Die weißen Stühle, die zu diesem Zweck aufgestellt wurden, füllten sich lange bevor die Veranstaltung überhaupt begonnen hatte. Unter den Teilnehmenden waren nicht nur Überlebende wie Subašić. Auch zahlreiche hochrangige bosnische und österreichische Politiker:innen – darunter Željko Komšić, Vorsitzender des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Elmedin Konaković, Außenminister von Bosnien und Herzegowina, sowie Wiens Kultur- und Stadträtin Veronika Kaup-Hasler – nahmen teil, um ihre Solidarität mit den Opfern des Genozids am Rednerpult zu bekunden. Das trübe Wetter wirkte wie eine Metapher für die Schwere der Worte auf der Bühne und den Schmerz in den Herzen der Anwesenden.
Auf der weißen Kappe eines Mannes sind die Worte „Srebrenica ’95 Never Forget“ zu lesen. Viele im Publikum tragen sichtbar eine genähte Brosche mit einer weißen Blume und grünem Blütenstempel – das offizielle Symbol zur Erinnerung an den Völkermord von Srebrenica. Unter ihnen auch Amila Hadžić. „Wir sind hier, weil es immer noch Menschen gibt, die leugnen, dass Srebrenica ein Genozid war. Gleichzeitig suchen manche Mütter noch nach ihren verstorbenen Kindern. Deswegen ist es wichtig, dass hier so viele Menschen hinter den Opfern stehen“, sagt sie.





Erinnerung ans Versagen
Der Grundstein für das Denkmal wurde bereits vor rund drei Jahren gelegt. 2022 war der Verband maßgeblich daran beteiligt, dass der österreichische Nationalrat eine Entschließung zum Gedenken an den Völkermord in Srebrenica angenommen hat. Der Bau der Statue war der nächste logische Schritt. „Im September 2022 haben wir unmittelbar den Prozess zur Errichtung dieses Mahnmals begonnen“, so Saračević.
Mit dem Design des Denkmals wurden Hajrudin Diman, Adila Diman und Anita Zečić betraut, während die Ausführungsarbeiten von Ibrahim Čović und Melisa Čović realisiert wurden.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag – selbst der Standort am Platz der Vereinten Nationen, direkt zwischen einer grauen U-Bahn-Station und einer viel befahrenen Autostraße, hat einen wichtigen Grund. Denn nur ein bis zwei Gehminuten entfernt steht das Gebäude der Vereinten Nationen. Diese hatten Srebrenica nur wenige Monate vor dem Massaker zu einer internationalen Schutzzone erklärt.
Ihrem Versprechen, die Bevölkerung zu beschützen, konnten sie jedoch nicht nachkommen. „Dieser Ort zeigt im Auftrag ‚Nie wieder‘, dass die Vereinten Nationen alles daran setzen müssen, um ihrem Versprechen und ihrem Auftrag gerecht zu werden“, bekräftigte Meinl-Reisinger. „Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist notwendig, um langfristig friedliches Zusammenleben zu sichern. Versöhnung gibt es nur, wenn es Gerechtigkeit gibt“, fügte sie hinzu.
Demnach dient das Denkmal als Erinnerung und Mahnung für die nachkommenden Generationen zugleich. „Wir müssen uns dafür einsetzen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt“, warnt der junge Adis, der der Enthüllung im Publikum beigewohnt hatte. „Wir müssen uns gegen jeden weiteren Genozid stellen, sei es in der Ukraine, im Sudan oder in Palästina.“